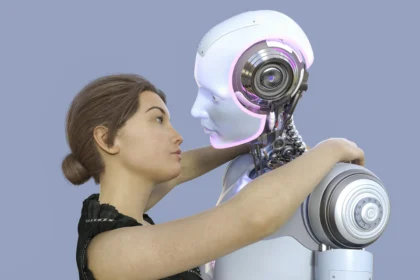ProRaus aus dem Schattendasein

Die vertrauten sicherheitspolitischen Zeiten sind vorbei. Deutschland muss sich ernsthaft mit der Frage der atomaren Bewaffnung auseinandersetzen, wenn es weiterhin auf geopolitischer Ebene respektiert werden will.
Es waren deutsche Wissenschaftler:innen, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Kernspaltung entdeckten – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Atombombe. Dennoch hat Deutschland bis heute keine eigenen Nuklearwaffen entwickelt.
Das liegt nicht nur an seiner besonderen Geschichte und damit einhergehenden Verantwortung, sondern auch an völkerrechtlichen Verpflichtungen. Mit dem Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag 1968 und der Wiedervereinigung 1990 im Rahmen des „Zwei-plus-Vier“-Vertrages bekannte sich Deutschland ausdrücklich zu einer atomwaffenfreien Politik: Deutschland darf keine Atomwaffen besitzen.
Doch internationale Abkommen können hinterfragt und – im Einvernehmen mit den Vertragspartnern – auch neu verhandelt werden. Vor allem dann, wenn sich die geopolitische Lage grundlegend verändert hat. Und das ist aktuell der Fall.
Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die USA unter ihrem rechtspopulistischen Präsidenten Donald Trump uns weiter bedingungslos beschützen werden. Dass wir das so lange geglaubt haben, entpuppt sich als Fehler. Es ist aber auch eine Chance für Deutschland, gewissermaßen „erwachsen“ zu werden und Verantwortung für seine eigene Verteidigung zu übernehmen. Als eine der wirtschaftlichen Führungsmächte Europas wäre das nicht nur angemessen, sondern ein Zeichen der Solidarität gegenüber anderen NATO-Partnern.
Nukleare Teilhabe
Im Übrigen ist Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt nicht atomwaffenfrei. Rund 20 US-Atomsprengköpfe sind im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO auf dem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Büchel stationiert. Im Ernstfall müssten deutsche Pilot:innen diese Waffen im Auftrag der NATO unter US-Kontrolle transportieren – eine Verpflichtung, über die in der deutschen Öffentlichkeit kaum gesprochen wird.
Der Atomwaffensperrvertrag von 1968 verankerte zwar das Ziel einer weltweiten nuklearen Abrüstung, eingelöst wurde dieses Versprechen leider bis heute nicht – und es spricht wenig dafür, dass sich das bald ändern könnte.
Dass ich als jemand mit pazifistischem, linkem Hintergrund über eine deutsche Atombewaffnung überhaupt nachdenke, irritiert mich selbst. Doch damit bin ich nicht allein: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für das Nachrichtenportal t-online befürworten 38 Prozent der Befragten eine eigene atomare Bewaffnung in Deutschland. Eine weitere Umfrage zeigt, dass sich sogar 52 Prozent zum Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland aussprechen.
Verteidigung ja, aber bitte nicht selbst. Diese Haltung ist auf Dauer nicht haltbar. Deutschland kann sich nicht ewig hinter seinen Nachbarn und Verbündeten verstecken. So wenig mir die nationalistische Denkweise gefällt: Wir müssen uns der Frage stellen, wie wir unsere Sicherheit in Zukunft ohne Abhängigkeit von anderen garantieren wollen. Denn sollte Marine Le Pen 2027 zur Präsidentin gewählt werden, wäre Frankreich als sicherheitspolitischer Partner kaum noch verlässlich – zu deutlich ist ihre Nähe zu Moskau, zu groß die Distanz zu multilateralen Bündnissen wie NATO und EU.
“Wir haben Waffen gegen Krieg getauscht”
Das führt leider zur unbequemen Frage: Inwiefern schützen uns internationale Abkommen noch? Oder anders gefragt: Hätte die Ukraine ihre Atomwaffen vor über dreißig Jahren nicht abgegeben, hätte sich Russland dann getraut, die Krim zu annektieren oder einen Angriffskrieg zu starten? Nach dem Zerfall der Sowjetunion besaß die Ukraine mehrere Tausend atomare Sprengköpfe. Mit dem “Budapester Memorandum“ von 1994 verpflichtete sich das Land zur vollständigen Abrüstung. Im Gegenzug garantierten die USA, Großbritannien und Russland die territoriale Integrität der Ukraine.
Viele Expert:innen und auch viele Ukrainer:innen sehen das “Budapester Memorandum“ heute als Fehler. Unter den Waffen, die die Ukraine an Russland übergab, waren einige strategische Bomber, die heute im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Das Abkommen hat also weder die ukrainische noch die transatlantische Sicherheit garantiert.
Auf einer Pressekonferenz im Dezember 2024 nannte der ukrainische Außenminister Andrjy Sibiyha das Abkommen einen „Fehler”. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj formulierte es noch drastischer: „Wir haben Atomwaffen für den Krieg getauscht“.
Der Stärkere gewinnt
So bitter es ist, in der heutigen Welt gilt nach wie vor das Prinzip: “Der Stärkere gewinnt”. Staaten mit Atomwaffen werden ernster genommen auch in Verhandlungen. Und lassen sich weniger erpressen.
Die Idee, dass Atomwaffen den Frieden sichern, entstammt der Logik des Kalten Krieges. Damals standen sich die USA und die UdSSR mit riesigen Atomwaffenarsenalen gegenüber – ein “Gleichgewicht des Schreckens”, das einen direkten Krieg verhindern sollte und ihn auch verhinderte. Auch heute funktioniert diese Logik teilweise: Seit Indien und Pakistan offiziell Atommächte sind, kam es zwischen beiden Ländern nicht mehr zu einem offenen Krieg.
Trotzdem: Die Vorstellung, dass Deutschland zur Atommacht wird, bleibt beunruhigend. Doch ebenso beunruhigend ist die geopolitische Lage und unsere Abhängigkeit von Schutzversprechen, deren Verlässlichkeit wankt.
Wir leben in einer privilegierten Demokratie. Wenn wir diese schützen und unsere viel beschworenen „europäischen Werte“ auch auf globaler Ebene verteidigen wollen, brauchen wir Einfluss und im Zweifel auch Abschreckung.
Ein möglicher Weg wäre ein europäischer nuklearer Schutzschirm, an dem sich Deutschland beteiligt. Im Ernstfall haben wir gegen Großmächte wie Russland oder China nur dann eine Chance, wenn wir als europäische Einheit auftreten. Nicht im nationalen Alleingang, aber auch nicht mehr im Schattendasein.