DebatteGeneration Y: Generation im Überfluss
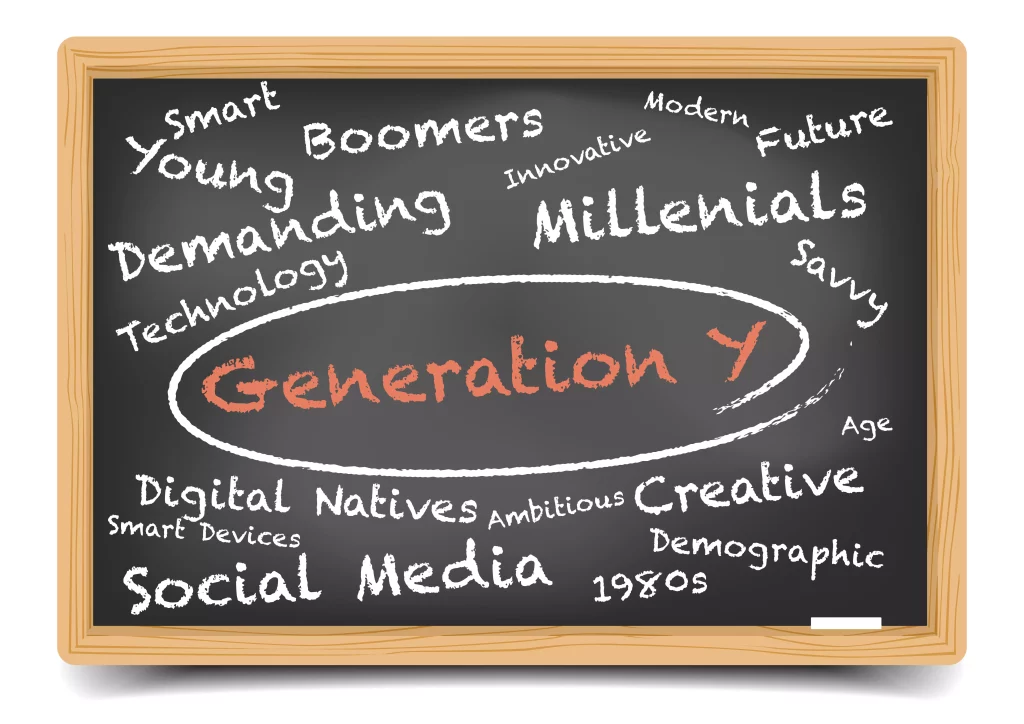
Die leidige Diskussion über die „Generation Why“ scheint kein Ende zu nehmen. Was fasziniert so sehr an dieser „Problemgeneration“? Eine Zustandsbeschreibung.
Als beziehungsunfähig und zerrissen werden die heute 17- bis 38-Jährigen beschrieben. Ihr Leben könnten sie nicht langfristig planen. Social Media beherrschten ihren Alltag. Die Generation Y sei von den vielen Möglichkeiten und Freiheiten, die ihnen das Leben biete, überfordert. Dabei sei sie die wohl bestausgebildete Generation überhaupt.
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“
Professor Paul Harvey von der University of New Hampshire vertritt die Auffassung, dass Anhänger der Generation Y unrealistische Erwartungen und eine starke Resistenz gegen negatives Feedback hätten. Sie seien unzufrieden mit ihrem Leben, da ihre Erwartungen sich nicht erfüllten. In einem Experiment befragte er Personen der Generation Y, ob sie sich im Allgemeinen besser qualifiziert fühlten als ihre Freunde oder Kollegen. Antworteten die Befragten mit „Ja“, fragte Harvey nach den Gründen. Viele Personen wussten keine Antwort. Harvey jedoch fand eine Antwort für die Antwortlosigkeit: Selbstüberschätzung.
Auf diese Fehleinschätzung geht auch der der Autor Tim Urban in seinem Artikel „Why Generation Y Yuppies Are Unhappy“1 ein. Schuld seien unsere Vorgängergenerationen. Zwar wollten wir heute genau wie unsere Eltern und Großeltern wirtschaftlichen Wohlstand, aber für uns spiele ein erfülltes Leben im Privaten sowie im Beruf eine größere Rolle.
Unsere Eltern hätten, so Urban, eine praktische und sichere Karriere angestrebt. Sie hätten gewusst, dass sie mit harter Arbeit ihre Ziele erreichen würden. In den 1970er und 1980er Jahren hätte die Gesellschaft einen bis dahin noch nicht dagewesenen wirtschaftlichen Wohlstand erlebt. Mit dieser erfolgsversprechenden, positiven Lebenseinstellung hätte die Gesellschaft ihre Kinder erzogen – die Generation Y. Mit den Worten „du kannst werden, was immer du willst“ im Ohr haben wir laut Urban das Licht der Welt erblickt.
Ich wollte mich von der Selbstüberschätzung meiner Generation selbst überzeugen und stellte in meinem Umfeld die gleichen Fragen wie Paul Harvey. Über die Hälfte der befragten Personen antwortete mit „Ja“ auf die Frage, ob sie besser qualifiziert als ihr Umfeld seien. Dafür konnten sie auch Gründe nennen: Auslandserfahrungen, Praktika und ehrenamtliches Engagement würden sie von Kommilitonen und Arbeitskollegen unterscheiden. Nur ein kleiner Teil der Befragten beantwortete die Frage nach der besseren Qualifikation mit „Nein“. Die Restlichen wehrten kritisch ab: So pauschal könnten sie das nicht beurteilen.
Der „Y-Not-Aktivist“

In meiner kleinen Umfrage ist deutlich geworden, dass sich viele mit dem Begriff der Generation Y schwer tun. So verallgemeinernd könnten die Menschen einer Altersgruppe nicht kategorisiert werden, hieß es oft.
Auch Kulturwissenschaftler Martin Hoffmann, einer der Befragten, schaute mich auf die Frage hin, ob er sich besser qualifiziert sehe als andere, perplex an. Wie er auf so eine Frage reagieren solle? Auf jeden Fall sei er ein „Y-Not-Aktivist“. Bereits während des Studiums hat Hoffmann ehrenamtlich gearbeitet, im Ausland gelebt und viele Erfahrungen gesammelt. So arbeitete er nach dem Bachelorstudium als Berater für Recruitment-Projekte. Aktuell veranstaltet er eine Film- und Dialogreihe zur Zukunft der Arbeit in Magdeburg. Sich selbst beschreibt er als Querdenker, Möglichmacher und Gesellschaftsaktivist.
Vor allem mag er nicht „Generation Y sein“. Rein rechnerisch gehört er allerdings dazu. „Generation Y ist ein Konstrukt aus dem Marketing. Man versucht, eine Alterskohorte zusammenzufassen, obwohl diese gerade unter den Jüngeren unglaublich divers ist“, sagt Hoffmann.
Als Kulturwissenschaftler stören ihn solche Klassifizierungen. Es ginge nur darum, zu erforschen, wie Leute in Zukunft arbeiten und leben wollen. Hoffmann beschäftigt sich selbst viel mit Arbeits- und Personalpolitik und kennt die Diskussionen.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, von der Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit und der Selbstverwirklichung, werde immer als Trend der jungen Leute dargestellt. Diese Bedürfnisse wüchsen allerdings generationsübergreifend, so Hoffmann. „Wir erleben gerade generell einen kulturellen Wandel. Dabei geht es um Emotionales, Empathie und soziale Verortung.“ Dieser kulturelle Wandel sei womöglich durch die Generation und die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in Gang gesetzt worden. Dennoch seien die Fragen, die innerhalb des Wandels aufkämen, generationsübergreifend, glaubt Hoffmann. „Ich denke nicht, dass eine Generation eine neue Gesellschaft produziert, sondern dass der Wandel der Gesellschaft eine neue Generation produziert hat.“
Die Sicherheit im Wandel
Der gesellschaftliche Umbruch führe zu der Dekonstruktion von sozialen Mustern. Das schüre Unsicherheiten bei den jüngeren Menschen. „Es gibt immer weniger Planbarkeit im Leben.“ Für die Zukunft sei es wichtig, zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. „Sicherheiten, wie wir sie noch aus dem Leben unserer Eltern kennen, wird es nie wieder geben“, so Hoffmann.
Mit den Unsicherheiten kämen aber auch viele Freiheiten. „Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass uns niemand mehr sagt, was wir tun sollen.“ Jeder müsse sich zukünftig seine eigenen sicherheitsgebenden Faktoren suchen. „Für den einen bedeutet das der Abschluss eines Bausparvertrags. Für mich persönlich liegt die Sicherheit gerade im Wandel.“
Aber was wäre die Alternative zur Unsicherheit? Wer würde heute freiwillig auf die vielen Freiheiten verzichten? Solange sich die Generation Y nicht auf die Unsicherheiten einlässt, wird uns das Thema weiter begleiten, scheint es. Vielleicht lernt unsere Generation irgendwann, dass Unsicherheiten nicht zwingend etwas Negatives bedeuten – spätestens dann, wenn neue Stabilitätsfaktoren entstehen, an denen sie sich orientieren kann. Wie diese aussehen, wird jeder für sich entscheiden müssen.
1 Vgl.: http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html


Es gibt weder Management 3.0 noch Arbeiten 4.0 noch Industrie 3.0 noch gibt es eine Generation „Y“.
Diese schwammigen Etiketten stehen Veränderung eher im Wege, als dass sie etwas bewirken.