Wie wir uns verändern
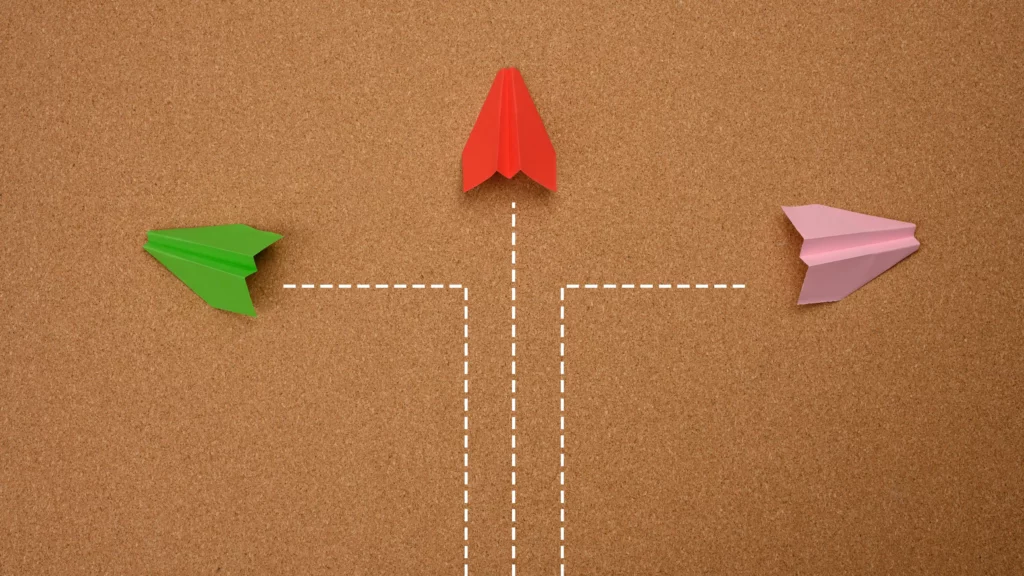
Bestand hat, was anpassungsfähig ist. Aber wovon hängt die individuelle, wovon die institutionelle Wandlungsfähigkeit ab? Damit der Gemeinsinn bei viel Flexibilität nicht auf der Strecke bleibt, müssen wir allerdings nicht konservativ werden. Zusammenhalt bedingt etwas Anderes.
Den äußeren Merkmalen unserer Freunde ordnen wir meistens auch innere Eigenschaften zu. Den stilleren Freund finden wir zurückhaltend und leistungsorientiert. Der andere, der laute und spontane Freund, ist herzlicher. Was uns ausmacht, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist unsere unmittelbare soziale Umgebung.
In dem Buch „Die Kunst gemeinsam zu handeln: Soziale Prozesse professionell steuern“ argumentiert das Autorenkollektiv um den Psychologen Stefan Hölscher, dass „innere Bilder“ und vor allem „kollektive Vorstellungen“ unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Egal, ob es sich um spontane Kontakte oder geplante Meetings handelt – der Erfolg einer Begegnung hängt immer auch vom Willen zur Zusammenarbeit, dem „Management sozialer Interaktionen“ ab.
Gesellschaft als konstruierte Wertegemeinschaft
Wie gehen wir mit Entscheidungen um? Stellen wir die richtigen Fragen? Reflektieren wir genug? Welche Prozesse sind wirklich produktiv? Fragen dieser Art betreffen den Einzelnen als individuellen Akteur gleichermaßen wie ganze Organisationssysteme.
Immerhin besteht der Kern einer jeglichen Institution – sei es die Familie, der Freundeskreis oder auch eine durch die Gesellschaft hervorgehobene Wertegemeinschaft – darin, durch Selbstzuschreibung Identität zu formen und zu erhalten. Dafür ist ein Zusammenhörigkeitsgefühl unabdingbar. Nur wer sich mit den vermittelten Sicht- und Herangehensweisen der Gruppe identifiziert, hat auch am Bestand dieser Gruppe Interesse.
Doch Zukunft gestalten heißt auch, Gegenwart zu verhandeln. Gruppenidentitäten sollten als das wahrgenommen werden, was sie sind: ein kommunikatives Konstrukt, ein veränderbares System.
Gruppen werten sich nach innen und außen auf
Der Soziologe Jan Fuhse von der Berliner Humboldt-Universität formuliert es so: „Gruppenkulturen entwickeln sich aufgrund der selbstreferenziellen Geschlossenheit der Gruppenkommunikation und laufen oft über eine normative Aufwertung der Gruppe gegenüber der Außenwelt.“
Sich als höherwertig zu betrachten, soll aber nicht nur in der Selbstdarstellung nach außen hin wirken. Ziel ist es auch, nach innen eine stabile, weil attraktive, Gruppenidentität aufzubauen. Kulturelle Traditionen, Normen und eine gemeinsame Sprache können dabei als Grundpfeiler dienen. Langfristig muss eine verlässliche Gruppenidentität allerdings auch anpassungsfähig und wandlungswillig sein.
Aber wieviel Veränderung verträgt eine Gemeinschaft? Ab wann gefährden Flexibilität und Eigensinn den ursprünglichen Charakter einer Gruppe, ihren Gemeinschaftssinn?
Demokratietauglich heißt, sich selbst zu hinterfragen
Die Orientierung, die eine Gruppe für den Einzelnen bereithält, transportiert laut Fuhse immer auch ein eher statisches „Modell des guten Lebens“. Als zu schützende Errungenschaft deklariert, lassen sich so konkrete Daseinsformen unterstützen oder unterbinden. Dabei macht letztlich die Freiheit, man selbst sein zu können, eine Demokratie aus.
Demokratietaugliche Gruppenidentitäten müssen im Umkehrschluss individuell interpretierte Ausführungen ihrer selbst zulassen, um ihrem Anspruch gerecht zu bleiben. Der Wirkbereich einzelner hängt von der Flexibilität aller Personen ab. Was als erhaltenswerter Kern oder verkrustetes Normengerüst gilt, lässt sich subjektiv schnell entscheiden. Bis sich jedoch eine ganze Gesellschaft neu strukturiert, bedarf es oft mehrerer Generationen.
Fast unerheblich ist dabei, ob gesellschaftliche Veränderungen das Ergebnis langwieriger, nach innen gerichteter Prozesse, oder Resultate eines von außen kommenden Schockerlebnisses sind.
Zu beachten ist dagegen, dass Terroranschläge wie die Anschläge von Paris im November 2015 Systeme nicht nur erschüttern. Sie stellen sie auch in Frage. Wie viel Freiheit ist zulässig? Darf ein nationaler Notstand universelle Werte wie die Menschenrechte außer Kraft setzen? Haben wir die richtigen Normen und Prinzipien als Leitmotive für uns selbst auserkoren?
Wandel und Erneuerung wird es immer geben
Auch technische Erfindungen, die rasante kulturell-soziale Umwälzungen mit sich bringen, stellen Gesellschaften auf eine harte Probe. Ebenso soziale Revolutionen wie der Arabische Frühling oder die Deutsche Wiedervereinigung. Jede moderne Gesellschaft sollte deshalb frühzeitig tragfähige Mechanismen finden, die ihr erlauben, Paradigmenwechsel friedlich vorzunehmen und blutige Auseinandersetzungen zu verhindern.
Tunesien etwa hat es nach langwierigen Auseinandersetzungen geschafft, sich 2014 eine demokratische Verfassung zu geben. „Insgesamt wurde seit der Revolution mehr gesellschaftliche Freiheit gewonnen, allerdings sehen liberal orientierte [Kräfte] die neuen Freiräume durch den zunehmenden sozialen Druck der moralisierenden islamisch‐konservativen Kräfte bereits wieder gefährdet“, kommentiert Isabel Schäfer vom Mittelmeer Institut Berlin die fragile Neuausrichtung der nordafrikanischen Republik.
Dass eine junge Demokratie wie die tunesische instabil daherkommt, schmälert nicht die Bedeutung der Sache selbst. Hinter gelebtem Pluralismus steckt das starke Verlangen vieler nach einer freiheitlichen, sozialen Demokratie. Alle sollen die gleichen Rechte haben. Sich zu dieser Gruppenidentität zu bekennen, fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. langfristig. Und hoffentlich bald auch unter Tunesiern.

