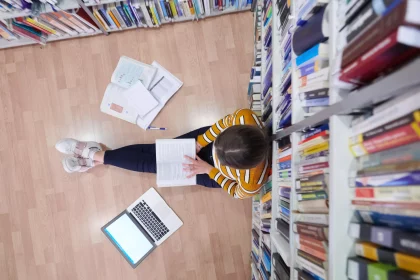Was sagen

Wie wenig wir voneinander wissen. Wissen wollen, wissen können? Die Berlinerin Melike Berfê Çınar bewegen diese Fragen heute mehr denn je.
Sagen wir, ich wohne in einer detailreich gentrifizierten Gegend. Schon lange, schon seit Zeiten der leistbaren Mieten, und die ziemlich gewaltvolle Windhose Verdrängung hat mich nicht fortgerissen. Hat mir eher Angenehmes beschert als Bedrohliches. Und, sagen wir weiter, eines der Details der neuen Zustände im Stadtteil ist, dass der Clash der Einfalt mit der Vielfalt ganz erheblich auf Spielplätzen donnert. Eigentlich hätte ich mir bei zwei Dritteln der Gespräche mit anderen Eltern im letzten Kita-Jahr vor der Schule einen Eimer für den andauernden Brechreiz um den Hals hängen müssen. Da geht es nämlich nur noch um die Einschulung zukünftiger Genies, Geschäftsführer:innen, Minister:innen und anderer edler Geschöpfe, könnte mensch meinen. Und um die Bedrohung durch die aus der Ferne eigentlich ganz schmucken Vielfalt.
„Es geht um die richtige Durchmischung“, sagen die Leute, die hier mit mir in unserer so schnell so stark veränderten Gegend wohnen. In dem Moment passieren gleich ein Dutzend Dinge: In meinem Mittelschichtsgewand werde ich zum Hulk, einem Hulk aber mit akuter Lebensmittelvergiftung. Und wie Rumpelstilzchen fühle ich mich in solchen Momenten auch, möchte toben und mir ein Bein ausreißen und zugleich wird die Umgebung zu einer 2D-Welt, in der ich nichts bewirken kann, wie im Alptraum. Denn solche Leute erklären sich selbst, wenn sie so reden, zu den überhaupt einzigen Leuten von Belang. Dass sie all denjenigen, die sie mit Ausdauer und Ignoranz abwerten, mit ihrer unversehrten Arroganz eine schallende Ohrfeige verpassen, diese Tatsache ist nicht Teil ihrer Wahrheiten. Dass sie selber so laut sind, dass viele andere gar nicht mehr gehört werden, keine Sprache mehr finden.
Dabei sind sie selber in ihren Augen ziemlich vielfältig: Stammen sie denn nicht aus Frankreich, Spanien, den USA und Niedersachsen? Ja, ist es denn nicht so, dass sie mal im Ausland eine NGO unterstützt haben und durchaus experimentierfreudig mit der eigenen Identität umgehen? Und das stimmt eventuell sogar. Ihre Binnenvielfalt mag vorhanden sein, was sie aber alle eint: Sie sind vor dem rassistischen Hintergrundrauschen unserer Gesellschaft aufgewachsen und davon selber nicht in dem Maße betroffen und darüber auch nicht in dem Maße reflektiert, dass ihnen klar werden könnte, welch gefährlichen und verletzenden Annahmen und Zuweisungen sie folgen, wenn sie „Durchmischung“ sagen und damit „weniger Menschen mit arabischem oder türkischem Hintergrund“ meinen und den genannten Gruppen ihre eigene Vielfältigkeit und letztlich ihr Menschsein absprechen.
Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass die Anzahl derer, mit denen wir uns wahrhaftig verständigen können, viel kleiner ist, als ich so anzunehmen tendiere.
Weil wir so viel in Codes sprechen. Weil wir von so unterschiedlichen Dingen ausgehen. Weil es eben überhaupt nicht ausreicht, sich derselben Vokabeln zu bedienen, dieselbe Grammatik mehr oder weniger zu beherrschen. Als zum Beispiel mein Vater nach Deutschland an die Universität gekommen war, wurde er nach einer Weile zu einem deutschen Bekannten nach Hause eingeladen. Zum Abendessen. Mein Vater ging hin und wurde gefragt, ob er auch essen wolle. Aus Höflichkeit lehnte er zunächst mit knurrendem Magen ab, eingestellt auf das in der Türkei übliche Ritual des Hin und Her, bevor dann doch gemeinsam gegessen wird. „Nein, danke, keine Umstände“, sagte er und die deutschen Gastgebenden stellten den Teller wieder weg. Die wörtlich genommene Höflichkeit meines Vaters ließ ihn hungrig darüber staunen, dass in diesem Land das vertraute Ritual nicht nur nicht stattfand, es wurde schlicht nicht begriffen. Natürlich war er hungrig gekommen, er war ja zum Abendessen eingeladen worden! Sie hatten einander nicht verstanden. Das mag mit Kultur umschrieben werden, hat aber mit gemeinsamen Codes zu tun, damit, wer was womit meint und wer was verstehen kann. Es geht um sprachliche Codes, die wir gemeinsam haben oder eben nicht. Derer wir überhaupt gewahr sind. Und die es uns ermöglichen, einzuordnen, was wörtlich gemeint ist und was nur Teil eines Rituals. Und selbst dann gelingt uns die Decodierung einfacher Botschaften nicht automatisch – wie in diesem Fall geschehen.
Mit meiner deutschen Oma, die Akkordarbeiterin in einer Fabrik gewesen war, konnte ich mich über viele Jahre meiner Kindheit hinweg ganz hervorragend unterhalten. Wir hatten eine gemeinsame Sprache, wir lernten voneinander und gemeinsam. Ich allerdings hatte längst eine Klassenreise angetreten, von der ich selber gar nichts ahnte. Mit jeder Stunde, die ich in der anspruchsvoller werdenden Schule erfolgreich verbrachte, begab ich mich tiefer in eine Distanz zu meiner Oma. Es ergaben sich seltsam widerstreitende Gefühle in meinem Inneren, meine tiefe Zuneigung erfuhr plötzlich Bedingungen und Begrenzungen, ich empfand ihre Unkenntnis der englischen Sprache und ihre Schwerfälligkeit im Nachvollziehen philosophischer Ideen fast abstoßend und liebte sie zugleich aus tiefstem Herzen. Während ich in der Schule saß, hatte diese Oma, lange bevor sie Oma wurde, im Bunker gesessen oder nach Nahrung überall in der Stadt gesucht oder in Trümmerbergen gearbeitet. Aber so differenziert war mein Empfindungsleben nicht. Als sie mir das Rezept ihres berühmten Mohrrübeneintopfes beibringen wollte, ich aber verlangte, dass sie zunächst die Grundlagen des russischen Anarchismus begreifen sollte, scheiterten wir schmerzhaft aneinander.
Mit meiner türkischen Großmutter verhielt es sich nahezu umgekehrt: Durch eine politisch verursachte Unmöglichkeit der Einreise meines Vaters in die Türkei sahen wir einander kaum. Fast nie. Es gab kein Skype und für ausgiebige Telefonate reichten weder meine Türkischkenntnisse noch meine Beziehungsbasis zur Fern-Oma aus. Nach vorübergehender Überwindung der politisch gefährlichen Lage und meines Zuwachses an gemeinsamer Sprache, Französisch und philosophisch-politisches Wissen, zum Beispiel, wuchsen unsere Gesprächsthemen in dem Maße an, in dem sie mit der deutschen Oma abnahmen. Wir verbrachten die nun regelmäßigen, wenn auch dennoch seltenen, gemeinsamen Abende im Gespräch über den sprichwörtlichen Gott und die Welt.
Es bedarf also einiges mehr als eines B2-Nachweises in irgendeiner Sprache, um sich zu verstehen. Die Reflexion der eigenen Position im gesellschaftlichen Machtgefälle gehört ebenso dazu, wie die Kunst und der Mut, Räume für eine Verständigung der Vielen zu schaffen und zu schützen. In denen unbequeme Wahrheiten wahr sind und in denen es nicht selbstverständlich ist, Menschen mittels unserer Sprache und ausgesprochener Annahmen auszuschließen und zu erniedrigen. In denen Dialoge möglich sind, bei denen es keinen Gewinn als Gegensatz zur Niederlage gibt, sondern einen Gewinn für alle: die echte Vielfalt.