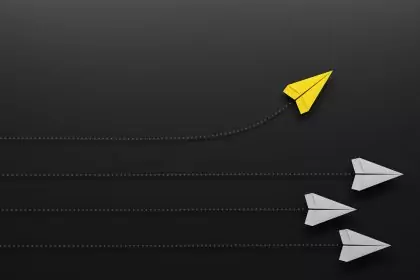Zum Schweigen verurteilt

Mehr als 50.000 Männer wurden seit dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland basierend auf den Regelungen des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch verurteilt. Ihr Vergehen: Homosexualität.
Bunt, laut, selbstbewusst – so stellt sich die LGBTQI-Gemeinschaft heute dar. Ein Zusammenschluss von Personen mit den entsprechenden sexuellen Orientierungen im Kampf gegen Diskriminierungen. Doch das ist noch nicht lange so.
Bis zum 11. Juni 1994 wurden sexuelle Handlungen zwischen Männern in der Bundesrepublik unter Strafe gestellt. Wer seine Homosexualität auslebte, musste dies vor der Gemeinschaft verheimlichen, um nicht vor Gericht zu landen. Erst 23 Jahre nach der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Liebe hat der Gesetzgeber 2017 die Rehabilitierung der Verurteilten beschlossen und im Juni dieses Jahres die Frist zur Beantragung von Entschädigungszahlungen verlängert.
Geschichte eines „Schandparagraphen“
Trotzdem gibt es dafür nur wenig Aufmerksamkeit. Selbst Aktivisten im Bereich Antidiskriminierung wissen heute nur ungenügend darüber Bescheid, inwieweit die bereits 1927 als „Schandparagraph“ bezeichnete Rechtsprechung in das Leben homosexueller Männer hineinwirkt.
Die Wurzeln der Strafbarkeit homosexueller Handlungen in Deutschland reichen tief in die Geschichte zurück. Im Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) aus dem Jahre 1871 stellte der noch junge deutsche Nationalstaat Männer an den Pranger wegen sogenannter „widernatürliche Unzucht“. Damit gemeint war der Geschlechtsverkehr zwischen Männern, der dort in einem Atemzug mit der Unzucht mit Tieren im § 175 Strafgesetzbuch (StGB) genannt wurde. Sanktioniert wurden die „Täter“ mit einer Gefängnisstrafe, inklusive sozialer Ächtung.
Diese Norm wurde 1935 durch die Nazis drastisch verschärft, die Straferwartung wurde auf bis zu zehn Jahre Zuchthaus (eine besonders strenge Form des Strafvollzugs mit Zwang zu schwerer körperlicher Arbeit) erhöht. Die DDR kehrte nach dem Zerfall des Dritten Reichs zur ursprünglichen Fassung zurück, schaffte die Regelung 1968 jedoch komplett ab. Die Bundesrepublik hingegen behielt die Fassung aus dem Jahre 1935 bei und milderte sie 1970.
Erst 1994 verschwand in der BRD der letzte Rest der Gesetzesnorm, die über mehr als ein Jahrhundert hinweg homosexuellen Geschlechtsverkehr kriminalisiert hatte. Über ein Jahrhundert, in dem Homosexuelle ihre sexuelle Orientierung verschwiegen, aus Angst vor schwerwiegenden Konsequenzen. Die wenigen, die sich outeten, riskierten ihre Freiheit.
Der lange Weg zur Entschädigung
Die – eher symbolische – Rehabilitierung der während der Nazi-Zeit Verurteilten sollte bis 2002 auf sich warten lassen. Die Aufhebung der Urteile der NS-Gerichte wurde damals unter Juristen kontrovers diskutiert, manch einer sah gar die Gewaltenteilung in Gefahr.
Erst 2017 konnte sich der Bund dazu durchringen, Kompensation für die Verurteilten zu leisten. Für Betroffene, die nicht gerichtlich belangt wurden, aber durch die Verfolgung beispielsweise wirtschaftliche Nachteile durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes ertragen mussten, gibt es seit 2019 die Möglichkeit, finanziell entschädigt zu werden.
Im selben Jahr hatte die Alternative für Deutschland (AfD) im Zuge dieser Entwicklung vergeblich versucht, gegen die „Ehe für alle“ vorzugehen. Die angedrohte Klage vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verlief jedoch ins Leere.
Zunächst wurde die Antragsfrist auf den 22. Juli 2022 festgesetzt. Nach neuerlichen Beratungen brachte die Bundesregierungeinen Gesetzentwurf ein, nach dessen Verabschiedung nun die Frist bis zum 21. Juli 2027 verlängert wurde. Viele fragen sich nun, warum?
Zusammenhängen dürfte dies mit der recht geringen Zahl der Antragssteller. Ersten Schätzungen zufolge ging man davon aus, dass sich die Entschädigungssumme, die der Bund aufbringen muss, auf circa 30 Millionen Euro belaufen würde. Stand April dieses Jahres wurde jedoch nicht mal eine Million Euro ausgezahlt.
Woran hapert es?
Zum einen gibt es ein Kommunikationsproblem. Das Bundesamt für Justiz (BfJ) stellt zwar auf seiner Website Informationen zu Wiedergutmachungszahlungen bereit und hält ein Antragsformular vor. In den Medien aber kommt die Thematik vergleichsweise selten auf, wodurch viele Menschen nicht wissen, welche Ansprüche sie haben und wie sie diese durchsetzen können.
Das bemängelt auch Grünen-Politiker und Mitglied des Bundestages (MdB) Max Lucks: „Parallel zu dieser Fristverlängerung braucht es nun auch mehr Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema, damit alle Betroffenen auch wirklich erreicht werden.“ Nötig sei mehr gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die Geschichte der Verfolgung Homosexueller in der Nachkriegszeit, beispielsweise durch verstärkte Thematisierung in den Schulen.
Und es gibt ein praktisches Problem: Einige der Betroffenen leben nicht mehr. Eine Auszahlung der Gelder an Angehörige ist nicht möglich. Diese sind zwar berechtigt, einen Antrag auf Ausstellung einer Rehabilitationsbescheinigung zu stellen, Entschädigungsleistungen sind jedoch nicht vererbbar und stehen ihnen damit nicht zu. Die Höhe dieses Schmerzensgelds ist ohnehin im Vergleich zum erlittenen Schaden der Verurteilten gering: 3.000 Euro je aufgehobenes Urteil, 1.500 Euro für jedes angefangene Jahr erlittenen Freiheitsentzuges. Für die, deren Existenz durch eine Verurteilung zerstört wurde, ist das nur ein schwacher Trost.
Das lange Stillschweigen über diesen hässlichen Fleck in der Geschichte des deutschen Rechtsstaates hat die Situation also nicht verbessert. Viele unter denen, die zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden, weil sie sich offen als die darstellten, die sie waren, konnten nie ihre offizielle soziale Rehabilitation miterleben. Die Debatte über die Verlängerung der Antragsfrist im Deutschen Bundestag hat der Problematik immerhin einen kurzen Aufmerksamkeitsschub beschert. Ob die grausame Vergangenheit hinter dem § 175 StGB im öffentlichen Bewusstsein präsenter wird, wird sich zeigen.