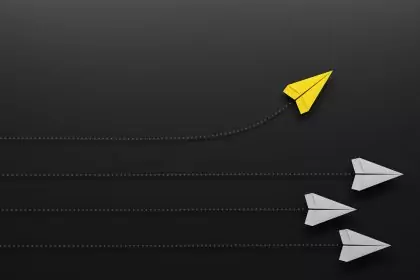Des Präsidents neue Freiheit

Als ich ein Kind war, sind meine Eltern mit meinem Bruder und mir aus Afghanistan geflohen. Knapp drei Monate nach dem Einmarsch der Sowjets und fast zwei Jahre nachdem sich die Kommunisten an die Macht geputscht hatten. Traumatisiert von den Erlebnissen in Kabul und durch die Stimmung, die in meiner Familie herrschte, habe ich trotz […]
Als ich ein Kind war, sind meine Eltern mit meinem Bruder und mir aus Afghanistan geflohen. Knapp drei Monate nach dem Einmarsch der Sowjets und fast zwei Jahre nachdem sich die Kommunisten an die Macht geputscht hatten. Traumatisiert von den Erlebnissen in Kabul und durch die Stimmung, die in meiner Familie herrschte, habe ich trotz meiner vier jungen Lebensjahre sehr deutlich mitbekommen, welches Gefühl es ist, wenn die Freiheit bedroht, gar zerstört wird. Im alten Westberlin, der Stadt, in der ich aufgewachsen und sozialisiert bin, habe ich wieder erfahren können, auf welch tönernen Füßen die Freiheit steht. War dieser Ort doch eine Insel, umgeben von einem Land, das seinen Bürgern die Freiheit verweigerte. Ironie unserer Fluchtgeschichte, dass wir ausgerechnet auf dem Stück deutschen Boden landeten, das sich NVA und Sowjetarmee als erstes unter den blutigen Nagel gerissen hätten.
In diesem Teil der Stadt habe ich Menschen kennen gelernt, die einen sehr ausgeprägten Freiheitsdrang hatten. Sie flohen aus Westdeutschland (damals schien es nur zwei Himmelsrichtungen zu geben) nach Westberlin, weil hier die bundesdeutsche Wehrpflicht nicht existierte. Dieser Ort war voller Freigeister, Alternativer und Punks. Außerdem waren jede Menge US-amerikanische, britische und französische Soldaten in der Stadt, die uns jedes Jahr am 17. Juni, dem damaligen Tag der Deutschen Einheit, mit einer großen Militärparade auf der Straße des 17. Juni daran erinnerten, warum sie hierher gekommen waren.
Als heranwachsender Berliner Junge habe ich im Laufe meiner Schulzeit von Lehrern unterschiedlicher politischer Couleur gelernt, in welcher Form, mit wessen Hilfe und unter welcher Kraftanstrengung dieses Land, das zu meiner Heimat wurde, nach dem Ende der NS-Diktatur ein neues demokratisches System auf die Beine gestellt hat. Ich habe gelernt, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit gibt, es aber dennoch immer darum geht, dass Freiheit die Freiheit des Andersdenkenden zu sein habe. Ich habe gelernt, dass Freiheit ein Spannungsfeld ist, in dem sich unterschiedliche Kräfte begegnen und aufeinander einwirken. Ich habe gelernt, dass dieses Kräftemessen etwas sehr Dynamisches ist – ein fruchtbarer und existentieller Prozess für pluralistische Gesellschaften. Ich habe gelernt, dass die freiheitlich demokratische Grundordnung jenen Rahmen setzt, innerhalb dessen genau diese Konfrontationen verschiedener Ansichten und Weltanschauungen ganz legitim stattfinden können, ja notwendig sind. Und schließlich habe ich gelernt, wie konstitutiv demokratische Legitimation für politische Entscheidungen und damit für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist.
Heute, im Jahr 2012, blicke ich auf ein Land, das zutiefst gespalten ist. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer mehr. Die Menschen sehen, wie Banken gerettet werden, ihre eigene Existenz aber bedroht ist. Sie werden Zeugen davon, dass Spekulatius leider nicht nur ein Gebäck zur Weihnachtszeit, sondern Lebensmotto ganzer Berufsstände geworden ist, die Ökonomien und Staaten ins Wanken bringen. Sie schauen auf eine politische Klasse, der Machterhalt und Mitnahmementalität häufig näher zu liegen scheinen als das Wohl der Menschen und des Landes. Christian Wulff, Klaus Wowereit und Kollegen lassen grüßen, von Granden wie Helmut Kohl ganz zu schweigen.
Unsere Gegenwart ist geprägt von Misstrauen, Angst und Spaltung. Wie in Krisenzeiten üblich, wirken auch jetzt wieder Fliehkräfte auf die Gesellschaft. Der Umgang von Innenminister Friedrich mit der kürzlich veröffentlichten Studie über Muslime in Deutschland fügt sich in eine Reihe von Beispielen ein, bei denen Minderheiten in Sippenhaft genommen und zu Feindbildern stilisiert werden, während „Ausländer“ sich fragen, wie eine braune Terrorzelle zehn Jahre lang mordend durchs Land touren konnte. Arbeitnehmer haben Angst um den Fortbestand ihres Betriebs, während sich Manager Milliardenboni auszahlen lassen, nachdem sie erfolgreich einen ökonomischen Karren nach dem anderen an die Wand gefahren haben. Soldaten werden in Kriegseinsätze geschickt, deren Sinnhaftigkeit selbst die ministerialen Befehlshaber nicht zu formulieren in der Lage sind. Die Liste ließe sich ewig fortführen.
In einer solchen Zeit erscheinen Gaucks Ansichten zur Freiheit anachronistisch. Während sich seit dem Mauerfall die Welt weitergedreht hat, scheint unser frisch vereidigter Bundespräsident ein Freiheitsbild zu haben, das bestenfalls im Jahr 1991 stecken geblieben ist. Damals wäre es zwar nicht realistischer, aber doch nachvollziehbarer gewesen. Nach dem Ende des sowjetischen Kommunismus ließ sich eine Reduzierung des Freiheitsbegriffs auf die Freiheit des Marktes als emotionaler Ausdruck weg lächeln, zu groß war die Freude über den Niedergang eines Systems, das die Planwirtschaft als der wirtschaftlichen Weisheit letzter Schluss feierte und dabei seine Bürger einsperrte, tyrannisierte und deportierte. Heute aber ist diese Ansicht nicht nur antiquiert, sondern, wenn es um das Amt des Bundespräsidenten geht, schlichtweg inadäquat. Wer eine solch eindimensionale Vorstellung von Freiheit hat, wird nicht jene Menschen verstehen können, von denen er hofft, dass sie seinen Appellen Aufmerksamkeit schenken. Wer in Zeiten von Finanzkrisen und Staatsbankrotten die Proteste von Menschen quer durch alle sozialen Schichten und Altersgruppen, zusammengefasst unter dem Motto Occupy, als albern bezeichnet, weil er das kapitalistische System heutiger Prägung als Naturgesetz zu verstehen scheint, der hat von der Dynamik und Vielschichtigkeit der Freiheit nicht viel verstanden, geschweige denn von der Dynamik des Kapitalismus.
Andererseits ist Joachim Gauck als Bundespräsident die logische Konsequenz einer Stimmung, die sich seit ca. zehn Jahren hierzulande breit macht. Der Begriff des Gutmenschen im Sinne eines Schimpfworts schwingt in vielen seiner Äußerungen mit. Ob die vermeintliche Appeasement-Politik der sozial-liberalen Koalition unter Brandt, ob die Ausführungen der Verfechter eines kulturell vielfältigen Deutschlands, ob die Kritiker einer Sozialpolitik, die dem freien Markt und sozialen Reformen die Stirn bieten, Gauck sieht in all diesen Akteuren Feinde „seiner“ Freiheit. Er denkt in Zusammenhängen einer bipolaren Geisteswelt. In seinen Gedanken setzt er den Kalten Krieg fort. Wer nicht für den freien Markt ist, wer nicht für den fordernden Staat ist, der kann nur eines im Sinn haben: ein kommunistisches System. In seinen Augen ist das Spannungsfeld, auf dem sich die verschiedenen Spielarten der Freiheit aufhalten, ein Schlachtfeld.
Wer sich selbst als Demokratielehrer bezeichnet, sollte nicht vergessen, was die Prämissen der Demokratie und der Freiheit sind. Wenn das verantwortungslose Handeln von Banken und Wirtschaftskonzernen (allesamt nicht durch ein Mandat der Bevölkerung legitimiert) den Primat der Politik unterminiert und das Schicksal ganzer Staaten bestimmt, dann kann und darf ein Bundespräsident nicht darüber hinwegsehen. Er muss die fehlende demokratische Legitimation problematisieren. Wer ein Liebhaber von Freiheit ist, darf sie nicht an kultureller Herkunft festmachen, sondern muss sie als universellen Wert verteidigen. Dazu zählt dann auch die Tatsache, dass es in Deutschland weiterhin ein engstirnig und reaktionär formuliertes Staatsbürgerschaftsrecht gibt, das Millionen von Menschen die Partizipation am politischen Leben verwehrt. Kurzum: Wer von Freiheit spricht, muss dafür sorgen, dass sie nicht Privileg einzelner, sondern Selbstverständlichkeit für alle ist.
Vielleicht ist Joachim Gauck seine Sichtweise nicht wirklich zu verübeln. Er wird nicht der einzige sein, dessen Biografie ihn politisch einseitig geprägt hat. Ob eine solche Person in das Amt des Bundespräsidenten gehievt werden muss, wage ich jedoch zu bezweifeln, erst recht in Zeiten wie dieser, in der die Freiheit prospektiv reflektiert und nicht nostalgisch verkürzt werden sollte, aus Liebe zu den eigenen Memoiren.
Aber er behauptet ja allenthalben von sich, er sei lernfähig.
Seine Antrittsrede am 23. März hat dies meines Erachtens ansatzweise gezeigt. Die Ausführungen über die Wechselwirkung zwischen Freiheit und Gerechtigkeit zeigen in eine Richtung, die zumindest zeitgemäßer wirkt als zuvor.
Interessanter wird es wohl, wenn er in weiteren Reden klar umreißt, was aus seiner Sicht Gerechtigkeit ist, wie sie hergestellt und aufrechterhalten werden kann, für wen sie in diesem Land gilt und was dies für die Freiheit bedeutet.
Ich bin und bleibe gespannt!
CROSSBLOG: Dieser Text ist in seiner ursprünglichen Fassung am 17.03.2012 auf carta.info erschienen.