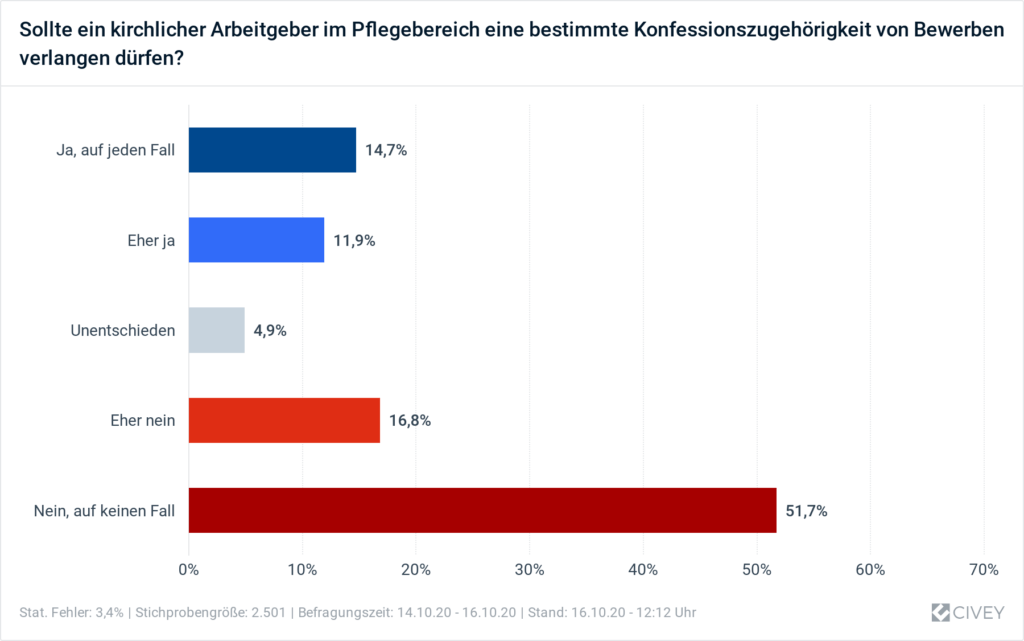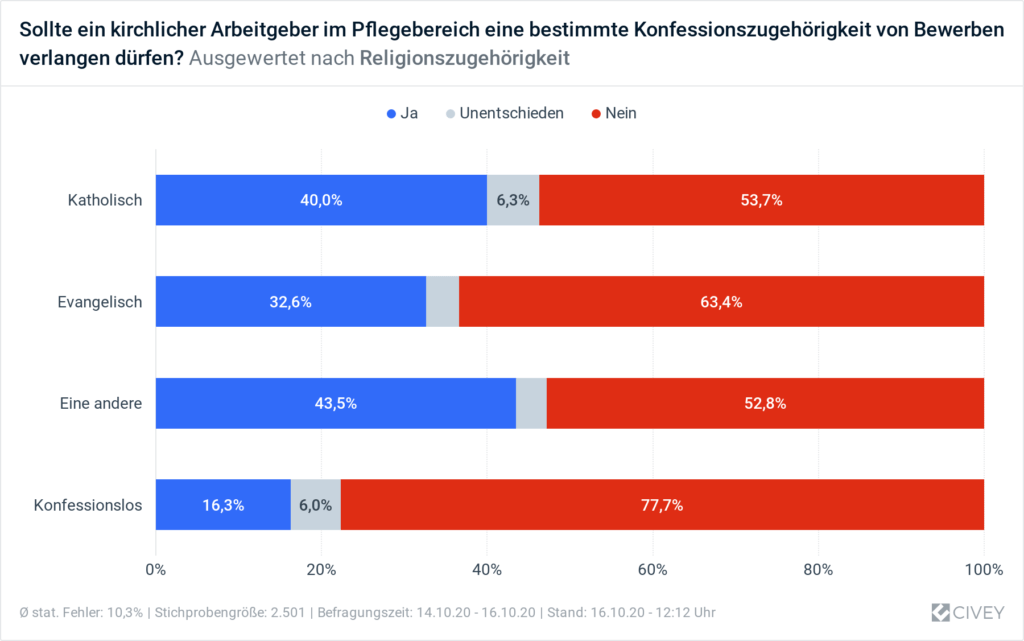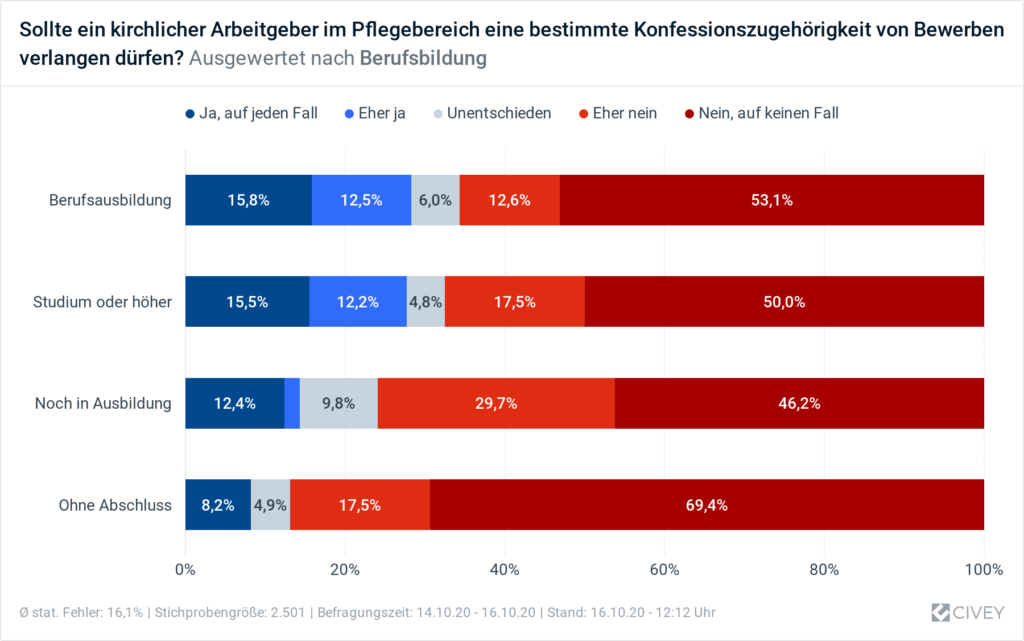DebatteSollten Pflegekräfte gläubig sein?

Die Kirchen sind die größten Arbeitgeberinnen in der Pflegebranche, in einigen Gegenden sind sie die einzigen Anbieterinnen ambulanter Dienste. Wer für sie arbeiten will, muss in der Regel christlich sozialisiert sein.
Deutschland wird älter. Wenn viele Menschen altern, brauchen auch mehr Menschen Pflege. Im Jahr 2017 gab es bereits 3,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Für sie standen 14.500 Pflegeheime und 14.100 ambulante Dienste zur Verfügung. Heute arbeiten mehr als eine Million Menschen in der Pflegebranche, die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist angespannt, es gibt mehr Stellen als Bewerber*innen. Das liegt auch daran, dass viele die Ausbildung abbrechen oder den Beruf wechseln; im Schnitt arbeiten Altenpfleger*innen nur acht Jahre in ihrem Job. Oft haben sie zu wenig Zeit für die Menschen, die sie pflegen, und fühlen sich von der Gesellschaft zu wenig wertgeschätzt.
In Deutschland gilt der Grundsatz, dass jeder Mensch selbst wählen kann, von wem und wo er gepflegt werden will: zu Hause von Angehörigen, mit oder ohne Unterstützung ambulanter Dienste, oder Vollzeit in einer stationären Pflegeeinrichtung. Viele Heime und ambulante Dienste werden von kirchlichen Trägern betrieben, Caritas (katholische Kirche) und Diakonie (evangelisch) betreiben jeweils knapp 2.000 stationäre und 1.500 ambulante Einrichtungen. Gerade auf dem Land sind es oft nur noch die Kirchen, die ambulante Dienste anbieten.
Kündigung wegen Scheidung, Kirchenaustritt oder Homosexualität: Für Beschäftigte der Caritas gilt die kirchliche Grundordnung
Wer für die Caritas oder die Diakonie arbeiten will, muss (fast immer) christlichen Glaubens sein. Die Kirchen berufen sich auf ihr Selbstbestimmungsrecht, im Grundgesetz heißt es in Artikel 140: „Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze“, der Artikel wurde aus der Verfassung des Weimarer Reichs von 1919 übernommen. Für die Beschäftigten der Kirche bedeutet das ein eigenes Arbeitsrecht. So sind Streiks nicht vorgesehen (bis 2012 urteilte das Bundesarbeitsgericht, Streiks seien nicht mit den kirchlichen Leitsätzen vereinbar), Streitfälle klären kirchliche Gerichte.
Weitere Vorgaben finden sich in der Kirchlichen Grundordnung, die deutschen Bischöfe haben sie 2015 angepasst. Demnach können auch Nicht-Christen für die Caritas arbeiten, solange sie die christlich-katholische Grundhaltung teilen. Wer aber aus der katholischen Kirche austritt, könne sich wohl nicht mehr mit den Werten derselben identifizieren – „dies ist aber eine wichtige Voraussetzung, wenn man den christlichen Dienst am Nächsten leisten möchte“, erklärt die Caritas. Kirchenaustritt ist damit ein Kündigungsgrund.
Und im Jahr 2020 kann auch eine Privatangelegenheit wie Homosexualität zum Problem werden. Da gleichgeschlechtliche Ehen von der katholischen Kirche nicht anerkannt werden, müsse geprüft werden, ob damit gegen Loyalitätsobliegenheiten verstoßen werde, heißt es. Das sei dann der Fall, wenn jemand öffentlich gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche eintrete oder persönlich durch sittliche Verfehlungen die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigen könnten. Die Caritas schreibt trotzdem: „Eine Diskriminierung aufgrund der Sexualität gibt es bei der Caritas nicht.“
Kirchliche Selbstbestimmung vs. Recht auf Nichtdiskriminierung
Das Grundgesetz sieht zwar für Kirchen ein Selbstbestimmungsrecht vor, es garantiert aber allen Menschen auch Nichtdiskriminierung: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Wenn kirchliche Träger Stellen ausschreiben und dabei eine bestimmte Konfession zur Voraussetzung machen, dann geraten diese beiden Rechte miteinander in Konflikt.
2012 klagte eine Frau, die sich bei der Diakonie auf eine Stelle als Referentin für die UN-Antirassismus-Konvention beworben hatte und nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Sie vermutete ihre Konfessionslosigkeit als Grund; in der Ausschreibung war die Zugehörigkeit zu einer protestantischen Kirche gefordert worden. Der Fall landete beim Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser stellte im April 2018 fest, dass die Abwägung zwischen dem Recht der Kirchen auf Autonomie und dem Recht auf Schutz vor Diskriminierung in Bezug auf die Religionszugehörigkeit als Einstellungsvoraussetzung von einem innerstaatlichen Gericht überprüft werden müsse. Bis dahin hatte das Bundesarbeitsgericht nur die Plausibilität des Handelns der Kirche „auf der Grundlage des glaubensdefinierten Selbstverständnisses“ geprüft, heißt es in der Pressemitteilung zum Urteil. Das Bundesarbeitsgericht gab der Frau daraufhin Recht, die Diakonie musste knapp 4.000 Euro Entschädigung zahlen. Die Diakonie hat inzwischen Verfassungsklage eingereicht.
Die direkte Frage nach der Religionszugehörigkeit ist durch das Urteil des EuGH also nicht länger unproblematisch. Die Caritas gibt auf ihrer Website Tipps, welche Fragen bei Vorstellungsgesprächen noch erlaubt sind. Etwa: „Was verbinden Sie mit christlichen Werten?“ oder „Welche positiven beziehungsweise negativen Assoziationen verbinden Sie mit der katholischen Kirche?“ und gibt den unmissverständlichen Hinweis: „Wenn die Bewerber(innen) von sich aus ihre Kirchenzugehörigkeit mitteilen, ist das arbeitsrechtlich unschädlich.“
In der konkreten Arbeit gibt es kaum bemerkbare Unterschiede zwischen kirchlichen und öffentlichen Trägern. „Die Schwierigkeiten im Alltag der Beschäftigten sind überall gleich“, sagt Mario Gembus, Gewerkschaftssekretär von ver.di. Viele Pfleger*innen könnten ihrem eigenen Anspruch an gute Pflege unter den gegebenen Bedingungen nicht gerecht werden: „Überall steigt die Arbeitsintensität, wird zu wenig Personal eingestellt, müssen zu viele Menschen von zu wenig Pflegekräften versorgt werden. Die beschriebenen Probleme gelten für alle Träger.“