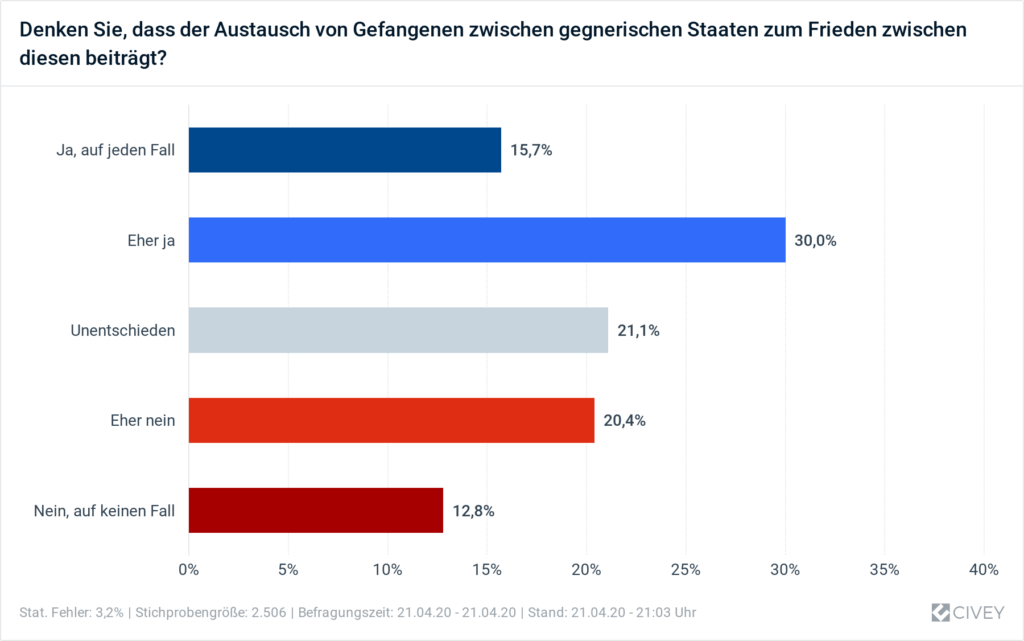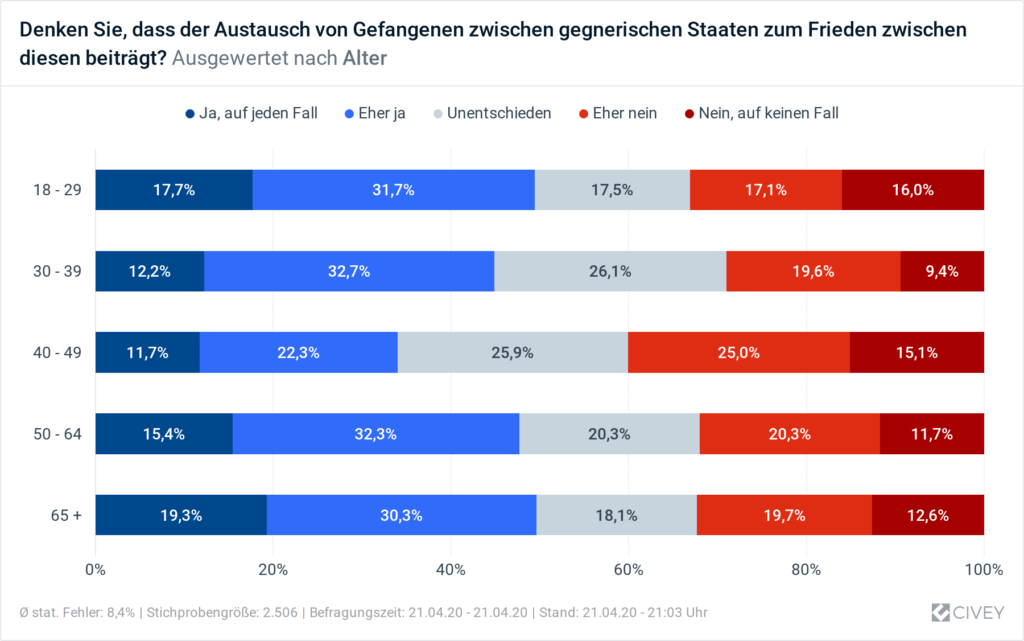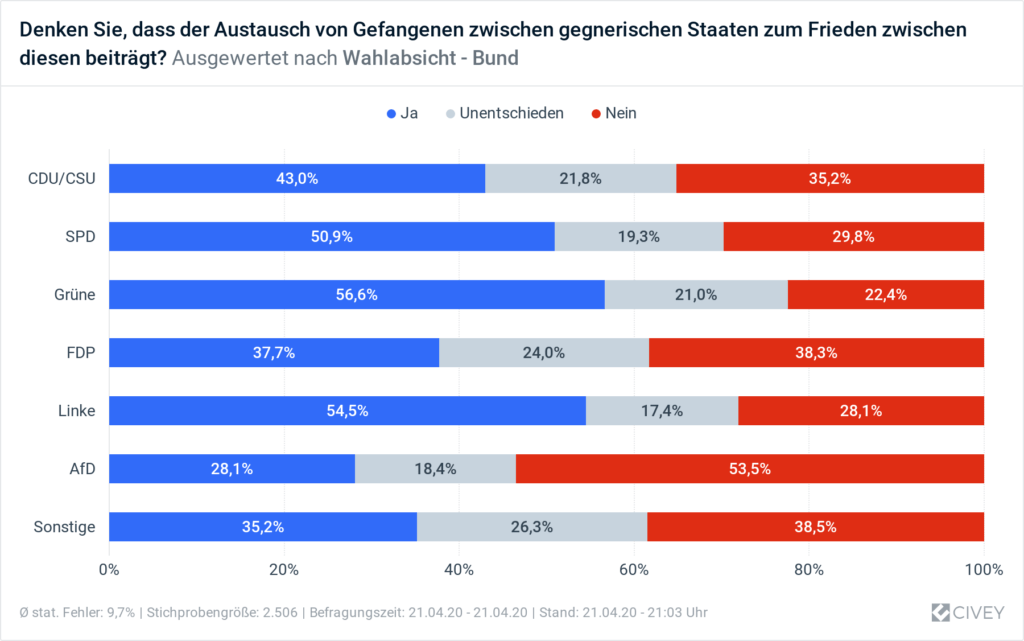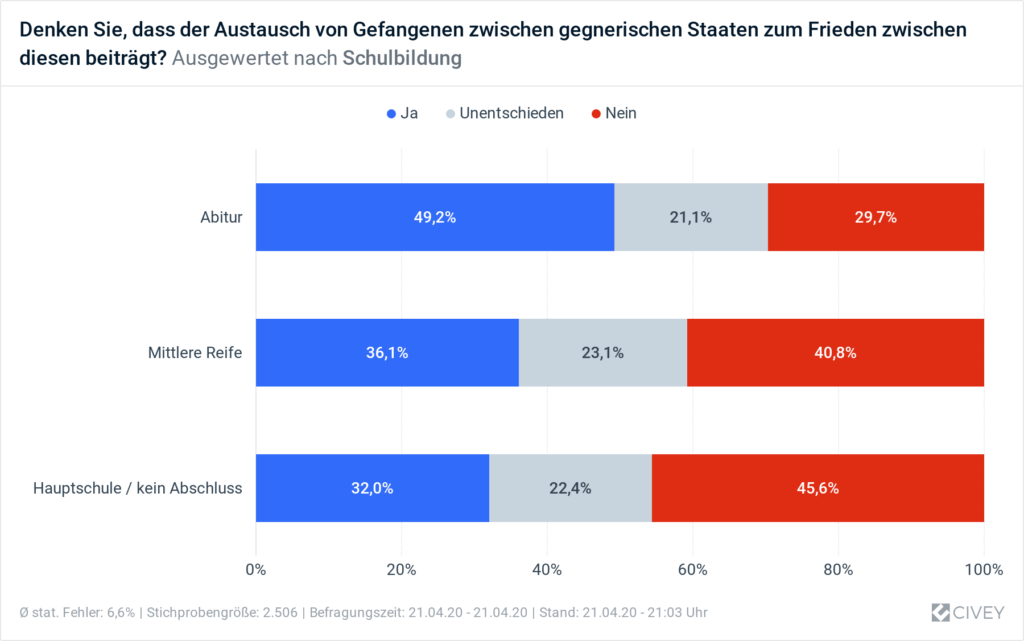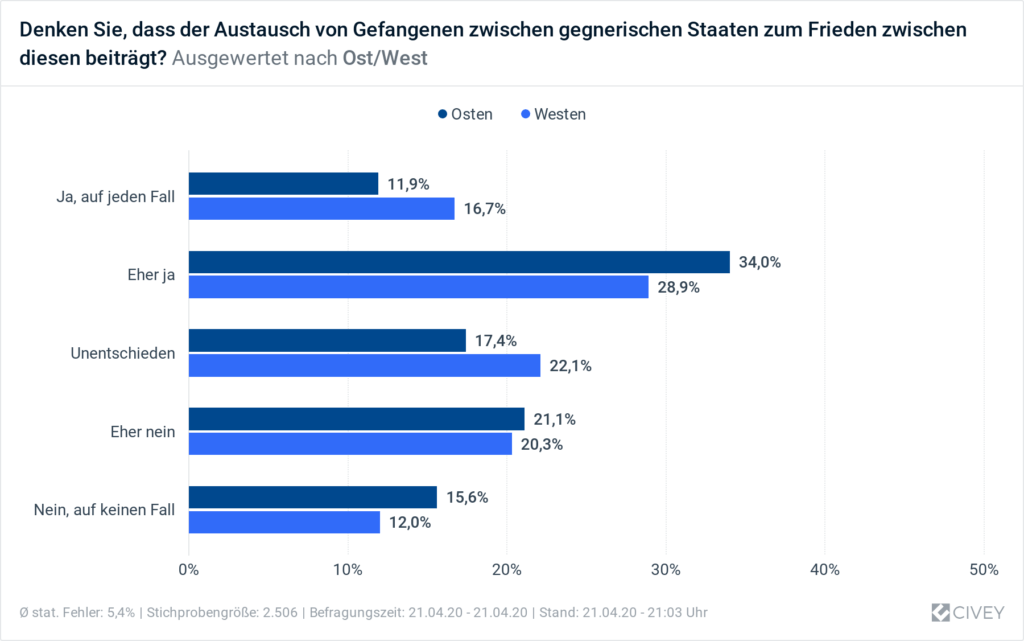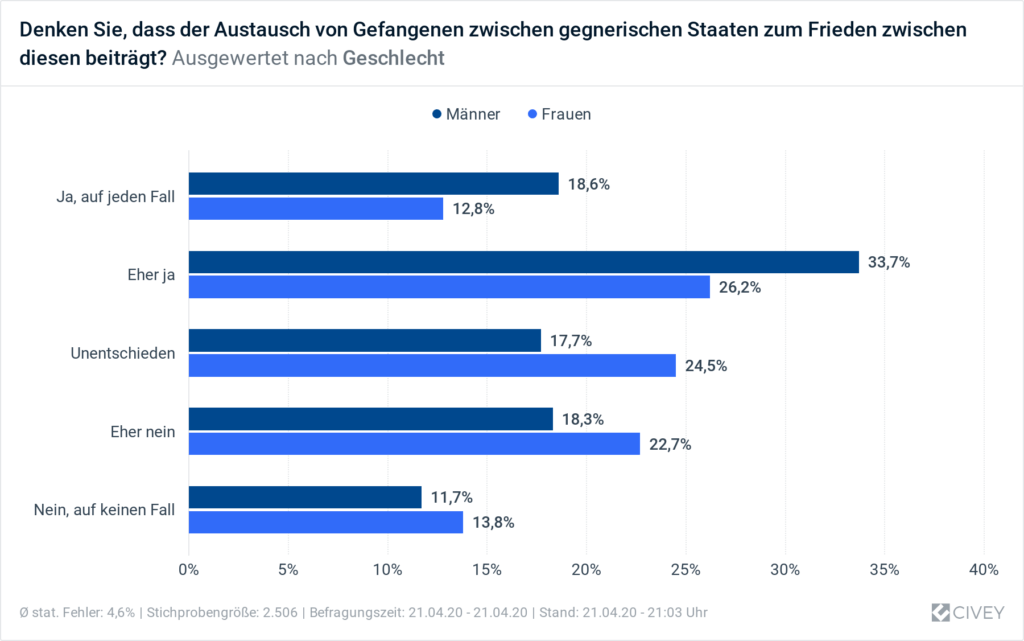DebatteGefangenenaustausche – ein sinnvolles staatliches Mittel?

Gefangenenaustausche sind so alt wie Kriege selbst. Doch bis es einen umfangreichen gesetzlichen Schutz für diese Praxis gab, vergingen Jahrhunderte. Und erleichtert hat das die Verhandlungen nur bedingt.
Im April hat die afghanische Regierung mehr als 300 inhaftierte Taliban-Kämpfer freigelassen. Im Ukraine-Konflikt haben das Kabinett in Kiew und die prorussischen Separatisten erstmals in diesem Jahr Gefangene in ihre Heimatregionen zurückgesandt.
Gefangenenaustausche sind Vereinbarungen zwischen Konfliktparteien und beruhen zugleich auf staatlichen Übereinkünften. Oft sollen sie neuen Schwung in festgefahrene Auseinandersetzungen bringen, sind dabei aber meist selbst das Resultat zäher Verhandlungen. Für die Freigelassenen und ihre Angehörigen sind Gefangenenaustausche eine Erlösung nach langem Warten, für Staaten dagegen häufig nur ein kleiner Schritt auf dem langwierigen – und nicht immer erfolgreichen – Weg der Friedensbildung.
Schon die alten Griechen kannten Gefangenenaustausche
Letzteres zeigte sich bereits in der Antike. Im Peloponnesischen Krieg vereinbarten die verfeindeten Streitkräfte Athen und Sparta 421 v. Chr. eine Waffenruhe, den sogenannten Nikiasfrieden. Dieser sah unter anderem vor, dass beide Seiten gefangene Krieger wieder auf freien Fuß setzten.
Dass dem Begriff „Nikiasfrieden“ heute die Bedeutung „fauler Frieden“ innewohnt, lässt erahnen, dass die Vereinbarung nicht von Erfolg gekrönt war. Sparta sah seine Interessen nicht berücksichtigt und geriet schon bald in neue Kämpfe mit Athen, was viele Inhaftierte das Leben kostete. Auch in den folgenden Jahrhunderten gab es für Kriegsgefangene oft nur die Wahl zwischen dem Tod und der Versklavung, obwohl mit dem Aufkommen des Christentums in der Region im 5. Jahrhundert der Loskauf oder Austausch von Gefangenen für den Sieger eines Kriegs üblich geworden war.
Besonders drastisch belegte den unzureichenden Schutz von Inhaftierten der Erste Weltkrieg, in dessen Verlauf sechs bis acht Millionen Soldaten in Gefangenschaft gerieten. Vor allem das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland waren auf diese Menschenmassen nicht vorbereitet und konnten die Inhaftierten oft nur unzureichend mit Nahrung und Medizin versorgen. Viele Kriegsparteien misshandelten die Soldaten körperlich und verpflichteten sie darüber hinaus zu Zwangsarbeit.
Genfer Konventionen bringen neue Regelungen für Kriegsgefangene
Erst nach Kriegsende verbesserte sich die Situation für Inhaftierte. Vertreter von 46 Staaten unterzeichneten am 27. Juli 1929 in Genf das „Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen“. Dieses verpflichtete die kriegführenden Parteien, „schwerkranke und schwerverwundete Kriegsgefangene, nachdem sie sie transportfähig gemacht haben, ohne Rücksicht auf Dienstgrad und Zahl in ihre Heimat zurückzusenden“.
Die neue Regelung erlaubte es dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Schwerverwundete in ihre Heimatländer zurückzubegleiten. Viele Inhaftierte verstarben jedoch auch in Gefangenschaft, da die maßgeblich am Krieg beteiligte Sowjetunion die Genfer Konvention nicht unterschrieben hatte und Deutschland bewusst gegen die Abmachungen verstieß.
Die Grenzen der Konvention
Weltweite Anerkennung erlangte erst die dritte Auflage der Genfer Konvention im Jahr 1949. Trotzdem brachte auch dieses umfassende Regelwerk keinen universellen Schutz für Gefangene.
Da sie sich auf Kriegsinhaftierte bezieht, bietet sie Häftlingen, die nicht unter diese Kategorie fallen, keinen Schutz. Politische Gefangene sind daher, damals wie heute, oft ein Spielball der Konfliktparteien. So verkaufte etwa die DDR bis 1989 tausende Häftlinge an die BRD, um sich von dem Erlös mit Sachleistungen zu versorgen, die in dem sozialistischen Staat für gewöhnlich knapp waren.
Zudem wurde die Genfer Konvention in einer Zeit verfasst, in der Konflikte überwiegend zwischen Staaten stattfanden. Heute hingegen brechen bewaffnete Auseinandersetzungen oft innerhalb eines Landes aus und involvieren irreguläre Gruppierungen – wie beispielsweise die prorussischen Separatisten in der Ukraine –, die gar nicht unter das Völkerrecht fallen. Terrororganisationen wie die Taliban ignorieren die Genfer Konvention.
Gefangenenaustausche bleiben schwer umsetzbar
Gefangenenaustausche bleiben eine schwierige Verhandlungssache. Oft sind sie erst nach monatelangen Gesprächen zwischen den Konfliktparteien und der Vermittlung durch eine dritte Instanz möglich.
Auch der Gefangenenaustausch zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung befand sich lange in der Schwebe. Das Abkommen über die gegenseitige Freilassung von Häftlingen schloss die Terrororganisation mit den USA. Die Regierung von Präsident Aschraf Ghani erkennen die Taliban nicht als legitim an. Zudem kam es beinahe zum Verhandlungsabbruch, als Kabul sich weigerte, 15 hochrangige Taliban-Kommandeure auf freien Fuß zu setzen. Diese seien „Mörder“ des afghanischen Volkes und würden nach einer Freilassung erneut versuchen, Provinzen zu erobern, begründete ein Regierungsunterhändler die Entscheidung vor Journalisten.
Inzwischen haben die Taliban offenbar eingelenkt und nach eigenen Angaben 60 Gefangene im Osten Afghanistans freigelassen.